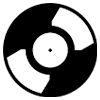Wiktor Robertowitsch Zoi (21. Juni 1962, Leningrad, UdSSR — 15. August 1990, 35. Kilometer der Fernstraße R-126 Sloka — Talsi, Rajon Tukums, Lettland) war ein sowjetischer Rockmusiker, Songwriter, Dichter, Künstler und Schauspieler koreanisch-russischer Herkunft. Er war Gründer und Frontmann der Rockband «Kino», die dem Leningrader Rock-Club angehörte und zunächst unter dem Namen «Garin i Giperboloidi» («Garin und die Hyperboloiden») auftrat. Zuvor spielte er in den Bands «Palata No. 6» («Abteilung Nr. 6») und «Avtomaticheskie udovletvoriteli» («Automatische Befriediger»).
Zoi gilt als einer der einflussreichsten und bekanntesten Rockmusiker der UdSSR. Er schrieb Texte und Musik, war Frontmann und wichtigste kreative Kraft von «Kino», die sich nach seinem Tod auflöste.
Das erste Album von «Kino» — «45» — erschien 1982. Insgesamt veröffentlichte die Band acht Studioalben, das letzte davon posthum. Die Besetzung wechselte mehrfach, stabilisierte sich aber Mitte der 1980er Jahre: Neben Wiktor gehörten Yuri Kasparyan, Georgi Guryanov und Igor Tikhomirov dazu.
Zojs Musik und Erscheinungsbild brachten das Phänomen der «Kinomania» hervor, und seine Songs bleiben auch für neue Generationen von Hörerinnen und Hörern unverkennbar und gefragt.
Biografie und Karriere
Frühe Jahre
Wiktor Zoi wurde am 21. Juni 1962 in Leningrad geboren. Seine Kindheit verbrachte er in der Gegend des Moskauer Siegesparks. Er war das einzige Kind eines Ingenieurs koreanischer Herkunft, Robert Maksimowitsch Zoi, und einer Sportlehrerin, Walentina Wassiljewna Zoi (geb. Gussewa).
In den 1970er Jahren besuchte Wiktor eine nahe gelegene Schule, an der seine Mutter unterrichtete. 1973 ließen sich seine Eltern scheiden, kamen aber etwa ein Jahr später wieder zusammen.
Von 1974 bis 1977 besuchte Zoi eine mittlere Kunstschule, in der sich sein erster musikalischer Freundeskreis bildete und die Band «Palata No. 6» entstand. In dieser Zeit schrieb er seine ersten Songtexte und begann, sich ernsthaft für Musik zu interessieren.
Später trat Wiktor in das Leningrader Kunstcollege namens W. A. Serow ein, wurde jedoch wegen schlechter Leistungen exmatrikuliert. Anschließend besuchte er eine Berufsschule (SGPTU-61) mit dem Schwerpunkt Holzschnitzerei und beherrschte das professionelle Schnitzen von Netsuke-Figuren.
In seiner Jugend war er ein Fan von Michail Bojarski und Wladimir Wyssozki, später begeisterte er sich für Bruce Lee. Er trainierte Kampfkünste und übte zusammen mit seinem späteren Bandkollegen Yuri Kasparyan.
Familie und Herkunft
Familie väterlicherseits
Der Familienname Zoi (das koreanische Choi, 최) gehört zu einem der alten koreanischen Clans. Auf der väterlichen Linie stammten Zojs Vorfahren aus der Gegend der Stadt Wonju auf der Koreanischen Halbinsel. Einer seiner Vorfahren, Zoi Yong Nam, siedelte Anfang des 20. Jahrhunderts nach Wladiwostok über, später wurde die Familie von den Deportationen der Koreaner in der UdSSR betroffen.
Sein Großvater väterlicherseits, Maksim Maksimowitsch Zoi, war Lehrer und wurde zusammen mit seiner Familie nach Kasachstan verbannt, wo er arbeitete und in den staatlichen Sicherheitsorganen diente. Er hatte mehrere Kinder, darunter Zojs Vater, Robert Maksimowitsch.
Zojs Vater wurde in der Kasachischen SSR geboren, zog später nach Leningrad, erwarb dort eine Ingenieurausbildung und lernte seine zukünftige Frau kennen. Er war es auch, der Wiktor die ersten Akkorde auf der Gitarre zeigte.
Auf der mütterlichen Seite stammte Zoi von russischen Bauern sowie Teilnehmern des Russisch-Japanischen Krieges und des Großen Vaterländischen Krieges ab, von denen einige die Blockade von Leningrad überlebten. Seine Mutter, Walentina Wassiljewna, lebte ihr ganzes Leben in der Stadt und arbeitete als Sportlehrerin.
Eigene Familie und Kinder
Zojs Ehefrau war Marjana (Marianna) Zoi (1959–2005). Die beiden lernten sich am 5. März 1982 bei einem Wohnungskonzert kennen, als Marjana im Zirkus arbeitete und für die szenische Gestaltung zuständig war. Nachdem sie Zojs Lieder gehört hatte, begann sie, die Band «Kino» zu unterstützen und zu promoten.
Die Ehe wurde am 4. Februar 1984 offiziell geschlossen. 1985 wurde ihr Sohn Alexander Zoi geboren — das einzige Kind des Musikers. Später arbeitete Alexander im Bereich Programmierung und Design, schrieb Musik und beteiligte sich an musikalischen Projekten.
Ende der 1980er Jahre trat Natalia Raslogowa, Filmwissenschaftlerin und Übersetzerin, in Zojs Leben. Wiktor und Natalia lernten sich bei Dreharbeiten kennen und zogen zusammen, obwohl er sich offiziell nie von Marjana scheiden ließ. Raslogowa war in seinen letzten Lebensjahren an seiner Seite und befand sich während seines Todes in Lettland.
Musikalische Karriere
«Palata No. 6» und «Avtomaticheskie udovletvoriteli»
Bereits an der Kunstschule entstand die Band «Palata No. 6» unter der Leitung von Maksim Paschkov, in der Zoi zunächst als Bassgitarrist und Co-Arrangeur auftrat. In dieser Zeit begann er, eigene Songs zu schreiben und sich als Sänger zu versuchen.
Ende der 1970er Jahre tauchte Wiktor in die Leningrader Punk- und Rock-Undergroundszene ein und lernte Andrei Panow (genannt «Swinoi»), den Kopf der Band «Avtomaticheskie udovletvoriteli», sowie den Gitarristen Alexei Rybin kennen. Mit «Avtomaticheskie udovletvoriteli» fuhr Zoi nach Moskau und spielte bei Untergrundkonzerten. In dieser Phase entstanden frühe Lieder wie «Moi druzya» («Meine Freunde»), die die Aufmerksamkeit der Rock-Szene auf sich zogen.
«Garin i Giperboloidi»
1981 beschloss Zoi im Urlaub auf der Krim gemeinsam mit Rybin und Oleg Walinski, eine eigene Band zu gründen, die den Namen «Garin i Giperboloidi» («Garin und die Hyperboloiden») erhielt, angeblich auf Vorschlag von Boris Grebenschtschikow.
Zurück in Leningrad begannen die Musiker zu proben und traten dem Leningrader Rock-Club bei. Im Januar 1982 wurde die Band offiziell in den Club aufgenommen. Auf der Grundlage dieses Projekts entstand wenig später die Band «Kino».
«Kino»
Erstes Album
Nach dem Ausscheiden von Oleg Walinski und der Umbenennung in «Kino» begann die Band mit der Arbeit am Debütalbum. Im Frühjahr 1982 wurde im Studio von Andrei Tropillo das Magnetband-Album «45» aufgenommen, dessen Titel auf die ungefähre Spieldauer in Minuten verweist. An den Aufnahmen waren Musiker der Band «Akvarium» («Aquarium») beteiligt, was den Klang des Materials stark prägte.
Parallel dazu begann «Kino», Wohnungskonzerte und Clubauftritte zu geben und gewann nach und nach an Popularität in Leningrad und Moskau. Viele Aufnahmen aus dieser Zeit verbreiteten sich im ganzen Land als inoffizielle Kopien und Bootlegs.
Zweite Besetzung von «Kino» und Durchbruch
Nach dem Weggang von Alexei Rybin änderte sich die Besetzung. Zu Zoi und Gitarrist Yuri Kasparyan stießen Bassist Alexander Titow (später von Igor Tikhomirov ersetzt) und Schlagzeuger Georgi Guryanov. Mitte der 1980er Jahre hatte sich damit die «klassische» Besetzung der Band herausgebildet.
In dieser Phase erschienen die Alben:
-
«Nachalnik Kamchatki» (1984),
-
«Eto ne lyubov» (1985),
-
«Noch» (1986),
-
«Gruppa krovi» (1988),
-
«Zvezda po imeni Solntse» (1989).
Zojs Arbeit im Heizkraftwerk «Kamchatka», wo er als Heizer tätig war, wurde ein wichtiger Teil seiner Biografie: Dort wurden Texte geschrieben, Proben abgehalten und erste Dokumentarfilme über die Leningrader Rockszene gedreht.
Die zweite Hälfte der 1980er Jahre brachte «Kino» landesweite Berühmtheit. Zojs Auftritte in den Filmen «Assa» und «Igla», die Veröffentlichung des Albums «Gruppa krovi» und des Songs «Peremen» («Veränderungen») machten die Band zu einem Symbol der Perestroika-Ära. Es folgten große Tourneen und Stadionkonzerte, darunter ein Auftritt im Luschniki-Stadion 1990.
1990 reisten Zoi und Kasparyan nach Lettland, wo sie mit einem mobilen Studio Material für ein neues Album vorbereiteten. Dieses wurde nach Zojs Tod von den übrigen Musikern fertiggestellt und unter dem Titel «Chyorny albom» («Das Schwarze Album», 1991) veröffentlicht.
Tod und Beerdigung
Am 15. August 1990 kam Wiktor Zoi bei einem Autounfall am 35. Kilometer der Fernstraße R-126 (heute R-128) Sloka — Talsi in Lettland, unweit von Jūrmala, ums Leben. Er war von einem Angelausflug mit einem «Moskwitsch-2141» auf dem Rückweg, als sein Wagen mit einem Linienbus kollidierte.
Die offizielle Untersuchung kam zu dem Schluss, dass Zoi die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, vermutlich, weil er am Steuer eingeschlafen war. Im Blut wurden weder Alkohol noch Betäubungsmittel festgestellt.
Die Beerdigung fand am 19. August 1990 auf dem Bogoslovskoje-Friedhof in Leningrad statt. Trotz der Bitte der Angehörigen, die Zahl der Trauergäste zu begrenzen, kamen Tausende Fans, um Abschied zu nehmen. Zojs Tod löste eine starke emotionale Reaktion aus; zahlreiche Fälle von Fan-Selbstmorden wurden bekannt.
Alternative Versionen seines Todes
Nach dem Unfall kursierten verschiedene alternative Erklärungen: von der Vermutung, er sei beim Kassettenwechsel im Autoradio abgelenkt gewesen, bis hin zu Verschwörungstheorien über einen gewaltsamen Tod. Die offizielle Version bleibt jedoch unverändert — überhöhte Geschwindigkeit und Verlust der Aufmerksamkeit auf einem schwierigen Straßenabschnitt.
Eigenarten und Analyse seines Schaffens
Ostphilosophie in Zojs Werk
Die kulturelle Doppelnatur — die Verbindung russischer und koreanischer (östlicher) Traditionen — wird häufig als wichtiger Bestandteil von Zojs künstlerischer Identität betrachtet. Sein Interesse an Kampfkünsten, an der Figur Bruce Lees sowie an daoistischen und buddhistischen Motiven prägte die Bildwelt seiner Texte:
-
Fokus auf dem inneren Weg und der Selbsterkenntnis;
-
Minimalismus in der Form bei hoher Dichte an Bedeutungen;
-
Betonung von Selbstkontrolle, Würde und persönlicher Verantwortung.
In vielen Liedern taucht die Idee auf, den «eigenen Weg» zu suchen und einem inneren Gesetz statt äußeren Regeln zu folgen.
Die lyrische Figur in Zojs Liedern
Die typische lyrische Figur in Zojs Songs ist ein einsamer, innerlich starker Mensch, der seine Distanz zur Außenwelt wahrnimmt und bereit ist, Verantwortung für seine Entscheidungen zu übernehmen. Diese Figur strebt nach Veränderung, Freiheit und Ehrlichkeit und steht häufig im Konflikt mit der Gesellschaft.
Zentrale Motive sind:
-
Krieg als Metapher für den inneren Kampf;
-
die Nacht als Raum der Selbsterkenntnis;
-
die Straße und der Weg als Bilder für Lebensentscheidungen;
-
der Stern als Symbol für Bestimmung und höheres Ziel.
Entwicklung der lyrischen Figur
Mit der Entwicklung der Diskografie wandelte sich diese Figur:
-
frühe Alben («45», «46») — der Held ist orientierungslos, fühlt sich der Welt entfremdet und sieht wenig Ausweg, bewahrt aber Hoffnung;
-
Mitte der 1980er («Nachalnik Kamchatki», «Eto ne lyubov», «Noch») — der Held wird sich seiner Andersartigkeit bewusst; es formiert sich Protest und die Weigerung, allgemeinen Regeln zu folgen;
-
«Gruppa krovi», «Zvezda po imeni Solntse» — der Held nimmt die Rolle eines Kämpfers an, ist bereit zur Konfrontation mit der Welt und folgt «dem Ruf des Sterns»;
-
«Chyorny albom» — das Gefühl eines nahenden Endes verstärkt sich, das Thema Einsamkeit tritt stärker hervor, und es stellt sich die Frage, wer den Weg weitergehen wird.
Kritik
Kritiker verwiesen oft auf den ausgeprägten Minimalismus von Zojs Poetik: einfache Worte, wiederkehrende Bilder, direkte Konstruktionen. Gerade in dieser Einfachheit sehen viele jedoch die Stärke seiner Texte: die Möglichkeit universeller Deutung, der beinahe «marschartige» Charakter und die Verbindung von Alltagsnähe mit philosophischer Tiefe.
Malerei
Zojs erster erlernter Beruf war der des Künstlers. Er war mit der Leningrader Kunst-Undergroundszene und der Gruppe «Novie khudozhniki» («Neue Künstler») verbunden und arbeitete in einer Mischung aus Primitivismus und Expressionismus, gelegentlich malte er auf Wachstuch, ähnlich wie Niko Pirosmani.
Seine Bilder zeichnen sich aus durch:
-
leuchtende, vereinfachte Formen;
-
kräftige Konturen und satte Farben;
-
Interesse an einer fast «höhlenmalereiartigen», graffitiähnlichen Bildsprache;
-
Themen wie Straße, Stadt und menschenähnliche Symbole.
Erste Ausstellung
Lange Zeit wurden Zojs Gemälde in privaten Archiven aufbewahrt. Seine erste große Ausstellung fand erst im 21. Jahrhundert statt, als Arbeiten aus der Sammlung von Natalia Raslogowa und anderen Besitzern gezeigt wurden. Die Schau bestätigte das Interesse an Zoi als eigenständigem Künstler und nicht nur als Musiker.
Ausstellungs-Biopics
In den 2020er Jahren wurden groß angelegte «Biopic»-Ausstellungen organisiert, die Malerei, Dokumente, persönliche Gegenstände, Musik und Videomaterial kombinierten. Dort wurden Dutzende Werke Zojs, Skizzen, Gitarren und Filmaufnahmen gezeigt, die verschiedene Seiten seines Schaffens — von Rockmusik bis Film und bildender Kunst — beleuchteten.
Motiv von Tod und Autounfall
In Zojs späten Bildern tauchen Motive von Straßen und Autos immer häufiger auf. Gemälde mit Darstellungen von Fernstraßen, Fahrzeugen und Figuren unterwegs entstanden kurz vor seinem Tod, was zahlreiche Interpretationen und Gespräche über den «prophetischen» Charakter dieser Motive auslöste.
Fälschungen
Mit dem wachsenden Interesse an Zojs Malerei kamen auf dem Kunstmarkt zahlreiche Fälschungen auf, oft ohne dokumentierte Herkunft. Das wurde zu einem ernsten Problem für Sammler und Expertinnen, ist aber zugleich ein indirektes Zeichen seiner Bedeutung als bildender Künstler.
Ausgewählte Filmografie
Wiktor Zoi wirkte in acht Filmen und mehreren Fernsehsendungen mit. Zu den wichtigsten Arbeiten zählen:
-
«Yya-kha» (Kurzfilm, Cameo);
-
«Konets kanikul» («Ende der Ferien», Musikfilm mit der Band «Kino»);
-
«Dialogi» («Dialoge», Dokumentarfilm über «Pop-mekhanika»);
-
«Rock» (Dokumentarfilm von Alexei Utschitel);
-
«Assa» (Kurzauftritt, Schlussperformance mit dem Song «Peremen»);
-
«Igla» («Die Nadel», Hauptrolle als Moro — für diese Leistung wurde er in einer Umfrage der Zeitschrift «Sowetskij ekran» zum Schauspieler des Jahres gewählt);
-
Auftritte und Konzertmitschnitte in einer Reihe weiterer Produktionen.
Diskografie
Mit der Band «Kino» (Studioalben)
-
1982 — «45»
-
1983 — «46»
-
1984 — «Nachalnik Kamchatki»
-
1985 — «Eto ne lyubov»
-
1986 — «Noch»
-
1988 — «Gruppa krovi»
-
1989 — «Zvezda po imeni Solntse»
-
1991 — «Chyorny albom» (posthume Veröffentlichung)
Neben den Studioalben existiert eine große Anzahl von Compilations, Liveaufnahmen, Neuauflagen und posthum rekonstruierten Stücken («Ataman», späte Singles mit Remixen und neuen Arrangements).
Vermächtnis
Denkmäler
Zum Gedenken an Wiktor Zoi wurden zahlreiche Denkmäler und Gedenkstätten errichtet:
-
Gedenkmonumente an der Unfallstelle an der Straße Sloka — Talsi in Lettland;
-
Denkmäler in Sankt Petersburg (unter anderem an der Heizhaus-Museum «Kamchatka» und im Park am Prospekt Veteranow);
-
Skulpturen in Barnaul, Okulowka, Almaty, Elista, Kurgan und anderen Städten;
-
temporäre und permanente Gedenkorte, die zu Jubiläen eröffnet wurden.
«Zois Orte»
Zu den sogenannten «Orten Zois» zählen:
-
sein Grab auf dem Bogoslovskoje-Friedhof in Sankt Petersburg;
-
das Heizhaus-Museum «Kamchatka» in der Blokhin-Straße;
-
Drehorte von Filmen («Igla», «Konets kanikul» u. a.);
-
Plätze, die mit seinen Auftritten und seinem frühen Leben verbunden sind.
«Zois Wände»
Moskau
Die bekannteste «Zoi-Wand» befindet sich in der Krivoarbatski-Gasse (Alt-Arbat). Sie entstand nach seinem Tod und wurde mit «Zoi lebt»-Parolen, Textzitaten und Zeichnungen bedeckt. Die Wand wurde zu einem Treffpunkt für Fans und zu einem Symbol für ihre Erinnerung.
Ukraine
«Zoi-Wände» entstanden auch in Kyjiw, Dnipro, Kamjanske und anderen Städten, oft an Uferpromenaden oder in zentralen Bezirken, wo Fans zusammenkommen, seine Lieder singen und Botschaften hinterlassen.
Belarus
Gedenkwände gibt es in Minsk und Mahiljou; sie sind sowohl Teil des öffentlichen Raums als auch informelle Gedenkstätten.
Heizhaus-Museum «Kamchatka»
«Kamchatka» ist ein ehemaliges Heizhaus in Sankt Petersburg, in dem Zoi Mitte der 1980er Jahre arbeitete und in dem viele Mitglieder des Leningrader Rock-Clubs probten. Heute ist es ein Club-Museum mit einer Ausstellung, die «Kino» und der Rockszene jener Zeit gewidmet ist.
Straßen
In verschiedenen Städten Russlands und Kasachstans wurden Straßen nach Wiktor Zoi benannt. Dies spiegelt den Übergang von informeller Erinnerung zur offiziellen Anerkennung seines Beitrags zur Kultur wider.
Parks und Plätze
Parks und Plätze, die seinen Namen tragen, gibt es unter anderem in Sankt Petersburg (in der Nähe von «Kamchatka») und Krasnojarsk, wo Gedenksteine und ihm gewidmete Objekte aufgestellt wurden.
Gegenstände und Artefakte zu Ehren Zois
-
ein Asteroid wurde nach Wiktor Zoi benannt;
-
Gedenkmünzen und Briefmarken wurden herausgegeben;
-
sein Name und Motive aus seinen Liedern finden sich in Kunstobjekten, Street Art und Museumsausstellungen.
In Philatelie und Numismatik
Nationale Post- und Bankenemittenten griffen Zois Bild auf: Es wurden Briefmarken und Gedenkmünzen herausgegeben, die ihm und der Band «Kino» gewidmet sind.
In der Kultur
«Kinomania»
Das Phänomen der «Kinomania» bezeichnet die anhaltende Verehrung der Band «Kino» und von Wiktor Zoi persönlich, die bereits zu seinen Lebzeiten einsetzte und sich nach seinem Tod noch verstärkte. Typische Erscheinungsformen sind:
-
Nachahmung seines Kleidungsstils und seines Auftretens;
-
«Pilgerreisen» zu Orten, die mit seinem Namen verbunden sind;
-
die Verwendung seiner Lieder als Symbole des Protests und innerer Freiheit.
In der Literatur
Über Wiktor Zoi wurden zahlreiche biografische und belletristische Bücher geschrieben. In der Literatur erscheint er als Held seiner Epoche, als Symbol der Perestroika und als Figur, die mit den großen Musikerpersönlichkeiten der internationalen Rockszene verglichen wird.
Biografische Werke
Es gibt detaillierte Biografien, verfasst von Menschen aus seinem Umfeld, von Familienangehörigen und Journalistinnen, sowie grundlegende Studien zu seinem Leben und Werk.
In der Belletristik
Zoi tritt als Figur in Romanen der alternativen Geschichte und Science-Fiction auf, in denen Autorinnen und Autoren mögliche Szenarien seines weiteren Lebens und seiner «Rettung» entwerfen.
In der Musik
Die Lieder von «Kino» wurden unzählige Male neu interpretiert:
-
offizielle Tribute-Alben;
-
Coverversionen von Rock- und Rap-Künstlern;
-
symphonische Projekte mit Orchesterarrangements von Zois Songs;
-
Konzerte, die an Jubiläen und Gedenktage geknüpft sind.
Tribute-Projekte zu Ehren Wiktor Zois
Es erschienen Compilations mit bekannten Musikerinnen und Musikern, die seine Lieder in neuen Arrangements interpretieren, sowie große Konzertprogramme («Simfonicheskoe KINO», Projekte wie «KINoproby» u. a.).
Im Theater
Auf Bühnen zeitgenössischer Theater werden Stücke aufgeführt, die Zois Leben und Liedern gewidmet sind, wobei seine Musik als dramaturgische Grundlage und als Kommentar zum Bühnengeschehen dient.
Ausstellungen
Es finden umfangreiche Ausstellungen statt, die Zoi als Musiker und Künstler zeigen. Zu sehen sind seine Gemälde, Dokumente, Fotografien, Plakate, persönliche Gegenstände und multimediale Installationen, die verschiedene Facetten seiner Persönlichkeit sichtbar machen.
Fazit
Wiktor Zoi ist eine der zentralen Figuren der russischen Rockkultur und des kollektiven Bewusstseins am Ende des 20. Jahrhunderts. Seine Biografie vereint mehrere Bereiche: Musik, Film, Malerei, die informelle Bewegung und den offiziellen Kulturkanon. Zois Lieder sind weiterhin in Filmen, auf Demonstrationen, bei Konzerten und im Alltag zu hören, und sein Bild bleibt ein Symbol innerer Freiheit, Integrität und der Entschlossenheit, dem eigenen Weg konsequent zu folgen.